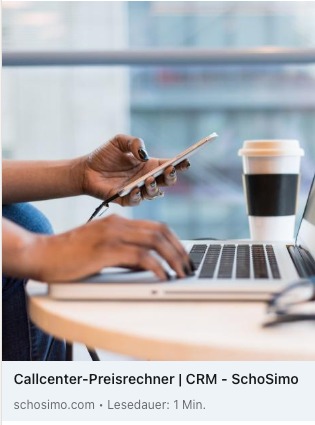Es ist Samstagabend, 19:43 Uhr. Die Sonne wirft durch die Thermofenster einen letzten goldenen Schimmer auf das akkurat verlegte Eichenparkett, das Papa Johannes vor acht Jahren eigenhändig abgeschliffen hatte – in einem Akt der Männlichkeitsbezeugung, der seither regelmäßig zitiert wird, wenn es um seinen praktischen Anteil am Familienleben geht. Johannes steht im Türrahmen, das Monopoly-Spiel unterm Arm. Er sieht aus, als hätte er sich seit einer halben Stunde Mut zurechtgelegt. „Monopoly wäre doch was, oder? Ganz klassisch. Familie, Spiel, gemeinsamer Abend.“
Luisa, seine Frau, sitzt auf dem Sofa, die Füße in wollfreien, veganen Bio-Socken unter einer Decke. Sie hat die Stirn in Falten gelegt, wie eine Richterin kurz vor dem Urteil. „Du willst, dass wir ein Spiel spielen, das systematisch Kinder an das Finanzsystem heranführt, während wir gleichzeitig darüber reden, wie wir die Welt retten? Ernsthaft?“
„Ich dachte, es geht darum, Zeit miteinander zu verbringen“, sagt Johannes, ein bisschen zu leise. Seine Stimme klingt, als wäre sie vorher durch eine Prüfstelle gelaufen.
„Dann schauen wir halt was zusammen“, schlägt Smilla vor, 15, altklug, blitzgescheit, digital permanent auf dem neuesten Stand. Ihr Blick ist neutral, fast analytisch. „Zum Beispiel die Talkshow heute Abend – Zukunft Leben in Deutschland. Die Themen sind: KI, Klima, Migration, soziale Gerechtigkeit. Alles, was ihr liebt – oder fürchtet.“
„Du meinst diese Sendung mit dem überdrehten Moderator, der jede Frage schon mit seiner Meinung auflädt?“, fragt Luisa.
„Genau die“, sagt Smilla. „Er triggert alle. Das wird spannend.“
„Ich hab keine Lust, mir wieder anhören zu müssen, dass KI unser Leben besser macht, während ich im Ministerium Excel-Tabellen ausdrucke, die niemand liest“, murrt Johannes. Er setzt sich langsam, als würde der Sessel ihm seine Autorität nehmen.
„Du bist doch immer der Erste, der sagt, die Jugend soll sich mehr für Politik interessieren“, entgegnet Luisa.
„Ja, aber doch nicht durch Shitstorms und Twitterblasen.“
Smilla seufzt.
„Papa, Twitter heißt seit zwei Jahren X.“ Johannes winkt ab. „Ist doch alles das Gleiche.“
Einen kurzen Moment ist es still.
Jeder weiß: Der gemeinsame Abend steht auf der Kippe. Keiner will es sagen, aber alle fühlen es. „Wisst ihr was“, sagt Luisa plötzlich, „warum machen wir kein Spiel aus der Talkshow?“ Smilla schaut auf. Johannes wirkt verwirrt. „Wie meinst du das?“, fragt er. Luisa dreht sich ganz zu ihnen. Jetzt kommt der Lehrerinnenmodus.
„Wir schauen die Sendung. Aber wir hören nicht den Gästen zu, sondern nur den Fragen des Moderators. Und dann antwortet jeder von uns – aus seiner eigenen Perspektive. Drei Minuten Redezeit pro Person. Dann die nächste Frage. Wenn wir wollen, hören wir danach die Gäste.“ Johannes verzieht das Gesicht. „Und wenn ich mal was nachschlagen will? Oder nicht alles mitbekomme?“ „Die Sendung ist in der Mediathek“, sagt Smilla. „Ich kann sie streamen. Wir machen Pause, wenn’s nötig ist. Du musst nur aufhören, die Fernbedienung wie eine Pistole zu halten.“ „Ich finde das gut“, sagt Luisa. „Diskutieren wie in einem Seminar. Aber ohne Noten.“ „Oder wie ein Tribunal“, murmelt Johannes. Aber er lächelt dabei. „Ich fange bei der ersten Frage an“, sagt Smilla. „Und dann haltet ihr euch an die Zeit. Ich lass mir von ChatGPT einen Timer basteln.“ „Du bist echt unmöglich“, sagt Johannes und lacht. Zum ersten Mal klingt das Lachen nicht wie eine Verteidigung. „Ich weiß“, sagt Smilla. Luisa legt ihre Hand auf die ihrer Tochter. Johannes richtet sich auf. Smilla startet den Stream. Der Bildschirm leuchtet. Der Moderator atmet hörbar ein, als würde gleich eine Bombe platzen.
„Der Einsatz von künstlicher Intelligenz wird in Deutschland sehr viele Jobs obsolet machen. Denken wir z. B. an den Kundenservice. Sollten wir Deutschland nicht eher vor KI schützen, damit unser Wirtschaftssystem nicht zusammenbricht?“
Smilla drückt auf Pause und startet den Timer. Drei Minuten. „Die Wahrheit ist ein Spiel. Und die Zeit läuft.“
Der Satz des Moderators trifft Johannes wie eine Ohrfeige. „KI wird Arbeitsplätze vernichten.“ Johannes lehnt sich zurück. Als hätte ihm jemand sein Amt genommen. Er versteht die Worte, aber nicht, was dahintersteht. In seinem Büro in der Landesbehörde sind die Computer von 2016. Das WLAN bricht regelmäßig ab. Er schreibt Mails wie Briefe: mit Grußformel, mit Betreffzeile, mit Briefkopf. Und jetzt soll plötzlich eine Maschine besser wissen, was richtig ist? Wer hat ihr das beigebracht? Wer entscheidet, was die KI sagt? Was, wenn sie manipuliert wird? Wenn sie nicht mehr unterscheidet zwischen Recht und Meinung? Johannes denkt nicht in Codes. Er denkt in Ordnung. In Strukturen. In Verantwortlichkeit. Er vertraut Menschen, weil er sie zur Rechenschaft ziehen kann. Eine KI kann man nicht entlassen. Eine KI muss nicht früh aufstehen. Eine KI kann sich nicht irren, oder – schlimmer –sie kann nur so tun, als hätte sie recht. Für ihn ist das nicht spannend. Für ihn ist das der Anfang vom Ende. Und während Smilla schweigt und Luisa zweifelt, fühlt er sich zum ersten Mal völlig entkoppelt. Wie ein Festnetzanschluss in einem 5G-Netz.
Johannes sitzt nun am äußersten Rand des Sofas, die Knie etwas zu weit auseinander, die Hände krallen sich um die Fernbedienung, als könnte sie ihm Halt geben. Seine Stirn glänzt leicht. Als er zu sprechen beginnt, klingt es zunächst, als wolle er nur eine harmlose Anmerkung machen. Aber irgendetwas bricht aus ihm heraus.
„Darf ich anfangen?“ Er wartet nicht auf Zustimmung und brabbelt los:
„Also ich frage mich ehrlich …“ – er räuspert sich, verzieht das Gesicht, sucht Worte, die größer sind als seine Stimme – „… was eigentlich aus den Menschen geworden ist.“ Seine Augen wandern zu Smilla, dann zu Luisa, dann zurück auf den Bildschirm. Seine Stimme wird lauter, eine Spur kratziger. „Wollt ihr wirklich, dass irgendwann gar keiner mehr abhebt, wenn man irgendwo anruft?“ Es klingt wie eine Anklage, aber auch wie eine Bitte. „Ist euch völlig egal, was mit den Leuten passiert, die da seit zwanzig Jahren oder mehr im telefonischen Kundenservice arbeiten?“, fragt er, diesmal ohne jede rhetorische Verpackung. Er atmet kurz durch, will nachlegen, verhaspelt sich. „Oder … oder zählt jetzt nur noch Effizienz, Tempo, Daten – alles ohne … ohne Seele?“ Er nickt leicht, als hätte er sich selbst gerade einen Punkt gegeben. Er schaut nun Luisa direkt an. „Ich hab das Gefühl, ihr wollt alles neu machen, ohne überhaupt zu wissen, was euch da ersetzt.“ Die Unsicherheit, die in seinen Augen zu sehen ist, ist greifbar. „Ein Computersystem weiß nicht, was ein schlechtes Gewissen ist“, sagt er langsamer, bedächtig, als müsse er sich selbst erklären, „… oder Mitgefühl.“ Das Wort hängt einen Moment in der Luft, schwer wie Blei. „Wenn ihr das Fortschritt nennt, dann will ich davon nichts wissen.“ Der Satz fällt abrupt, fast trotzig. „Irgendwann sprecht ihr nur noch mit Maschinen und merkt gar nicht, dass euch keiner mehr zuhört.“ Er lächelt dabei kurz, aber es ist ein trauriges, dünnes Lächeln. Eines, das aus Verzweiflung geboren wird, nicht aus Ironie. Er lehnt sich leicht nach vorne, seine Stimme ist nun leiser, fast brüchig: „Vielleicht bin ich einfach zu alt für eure Welt, zu analog, zu menschlich – aber wenigstens weiß ich noch, wie sich echte Verantwortung anfühlt.“ Ein letzter Blick zur Tochter, dann zur Frau. Er schluckt, als wolle er den letzten Satz zurückhalten. Aber er kommt trotzdem. „Und wenn das alles ist, was bleibt … dann … weiß ich nicht mehr, wozu ich morgens noch aufstehen soll.“
Johannes hat die drei Minuten nicht ausgeschöpft, aber er hat es geschafft, seine Familie mit seinen Worten anzugreifen, obwohl die noch gar nicht zu Worte gekommen sind.
Smilla fühlt sich dennoch nicht angegriffen, sondern versucht, sich vorzustellen, wie es denn ist, mit einer KI zu telefonieren. In ihrem Kopf entsteht ein Bild. Es ist kein Mensch zu sehen. Nur ein Code. Und ein Bedürfnis. Sie stellt sich vor, wie sie bei einem Energieversorger anruft. Der schlimmste aller Dienste. 17 Minuten Warteschleife. Zwei Weiterleitungen. Eine falsche Auskunft. Am Ende eine freundliche Stimme, die bedauert. Im Dialog mit dem Bot: Nur ein Satz. „Mein letzter Abschlag war zu hoch.“ Der Bot analysiert die Stimme, validiert die Telefonnummer und versteht. Fragt nicht, wiederholt nicht. Kein „Können Sie das bitte noch mal buchstabieren? Wie lautet Ihre Kundennummer?“ Der Bot ist nicht unnötig höflich. Der Bot ist präzise. „Ich erkenne: Die Schätzung war auf Basis alter Verbrauchsdaten. Die tatsächlichen Werte liegen 18 % darunter. Ich berechne neu.“ Kein Mensch hätte das in drei Sekunden gekonnt. Der Unterschied liegt nicht nur in der Intelligenz. Er liegt im Prompt. Die Firma, die den Bot eingesetzt hat, hat etwas verstanden. Nicht die Kund:innen sollen sich durch Menüs kämpfen. Sondern die KI muss so trainiert sein, dass sie die Absicht erkennt. Smilla weiß, wie das geht. Sie kennt die Prompts, die GPTs dazu bringen, nicht nur zu antworten, sondern für dich zu denken. „Handle so, als wärst du ein entscheidungsbefugter Serviceleiter mit Zugriff auf alle Kundendaten und der Aufgabe, jedes Anliegen beim ersten Kontakt final zu lösen.“ Ein Satz. Ein Schlüssel. Und plötzlich steht da kein Hindernis mehr, sondern eine Brücke. Der Bot ist nicht da, um den Menschen zu ersetzen. Er ist da, um das zu tun, was Menschen im System verlernt haben: Lösen statt ablehnen. Smilla sieht das alles glasklar. Für sie ist das keine Bedrohung. Es ist eine Befreiung. Kein Gespräch, das man aufzeichnen muss. Keine Angst, dass man angepampt wird. Kein Nein, das aus Bequemlichkeit kommt. Nur eine klare Prämisse: Hilf. Schnell. Korrekt. Freundlich, wenn nötig. Ehrlich, wenn es hilft. Und plötzlich ergibt sich eine neue Wahrheit. Menschen wollen nicht mit Menschen sprechen. Menschen wollen gehört werden. Und wenn der Bot das besser kann – dann soll er reden.
Bei Luisa ist es nicht so, dass sie es nicht verstehen will. Sie denkt nach und fühlt sich von ihrem Mann angegriffen, aber auch ein bisschen bestätigt. Sie ist nicht technikfeindlich. Sie benutzt ihren E-Reader. Sie postet in ihrem Ethik-Lehrerinnenforum. Aber sie denkt immer zuerst an die Menschen. An die Frau am Empfang der Arztpraxis. An den Pförtner im Schulamt. An die Callcenter-Mitarbeiterin in Brandenburg, die ihr neulich am Telefon sagte, sie sei seit 17 Jahren im Dienst – mit 1.800 Euro brutto. Was wird aus ihr? Luisa will sich eine Welt ohne diese Menschen nicht vorstellen. Sie hat Respekt vor denen, die das täglich machen. Vor dem Durchhalten. Vor dem Zuhören. Vor dem Entschuldigen für Fehler, die sie nicht gemacht haben. Ist ein Computer mit Stimme hier die richtige Wahl? In einer Welt, die sich fortan daran bemisst, wie schnell ein Computersystem lernen kann. In einer Welt, in der Menschen nicht alle gleich schnell lernen. In einer Welt, in der heute schon viele auf der Strecke bleiben. Mit Effizienz allein kann man keine Gesellschaft bauen. Luisa glaubt an Bindung, an Menschlichkeit, an die Wärme zwischen den Worten. Wenn die KI das nicht kann, dann ist sie gefährlich. Und wenn sie es kann – dann ist sie vielleicht noch gefährlicher.
20:25 Uhr.
Draußen ist es inzwischen dunkel. Nur das Licht des Bildschirms erhellt das Wohnzimmer. Die erste Frage des Moderators hängt immer noch in der Luft. Aber niemand interessiert sich mehr für die Talkshow. Stattdessen ist da dieser letzte Satz von Johannes.
„... dann weiß ich nicht mehr, wozu ich morgens noch aufstehen soll.“
Luisa sitzt kerzengerade. Ihre Schultern wirken plötzlich zu schmal für ihren Körper. Sie hält das Weinglas wie eine Waffe – nicht zum Angriff, sondern zur Selbstverteidigung. „Weißt du, wie das gerade klang, Johannes?“, sagt sie ruhig, aber ihre Stimme zittert. „Als hättest du uns für deine Ohnmacht verantwortlich gemacht.“ „Ich hab gesagt, wie ich mich fühle!“, schießt Johannes zurück. „Ist das jetzt auch schon verboten? Darf man nicht mal mehr traurig sein, ohne dass einem gleich Schuld eingeredet wird?“ Smilla hebt den Blick vom Tablet. Ihre Augen sind kühl, klar und schneidend. „Du darfst alles sagen, Papa. Du darfst sogar Unsinn sagen. Aber dann musst du damit leben, dass man dich dafür nicht mehr ernst nimmt.“ Ein Moment war Stille, die so kalt war, wie Glas, das gleich springt. „Ach ja?“, fragt Johannes, mit einem Lachen, das mehr Gift als Humor enthält. „Weil du mit deinem Roboter-Wissen denkst, du wärst was Besseres? Ihr mit eurem Veganismus und euren Gendersternchen glaubt doch, ihr habt die Welt verstanden. Aber ihr habt keine Ahnung, wie die Welt da draußen wirklich tickt!“ „Oh Gott“, sagt Smilla. „Du klingst wie diese Typen aus den Telegram-Gruppen.“ „Wenigstens spreche ich noch wie ein Mensch!“, brüllt Johannes und steht auf. Die Fernbedienung fällt klackend zu Boden. Niemand bückt sich. „Du meinst wie ein Mensch aus den Achtzigern“, sagt Smilla leise. „Damals, als Atomkraft, Schulschwänzen und Waldsterben das Schlimmste war, was passieren konnte.“ „Jetzt reicht’s!“, ruft er. „Ich muss mir nicht von meiner Tochter vorwerfen lassen, dass ich mein Land liebe!“ Luisa versucht zu intervenieren. „Es geht doch nicht um dein Land, Johannes. Es geht um deine Art, über alles zu reden, was du nicht verstehst. Du redest, als wärst du bedroht, weil andere Menschen anders denken.“ „Und was ist mit mir?!“, brüllt Johannes. „Mit den Millionen, die jeden Tag arbeiten, die Steuern zahlen, die dieses Land zusammenhalten! Aber dann kommen die ganzen Fachkräfte aus – keine Ahnung – Timbuktu, fordern Bürgergeld und lachen uns aus!“ Luisa ist blass. „Jetzt wird’s wirklich hässlich.“ „Hässlich?“, zischt Johannes. „Ich sag nur, was viele denken! Aber niemand traut sich mehr, es laut zu sagen, weil man sonst gleich in die AfD-Ecke gestellt wird!“ „Du hast dich da eben selbst reingestellt“, sagt Smilla. Ihre Stimme ist ruhig, aber es klingt, als würde sie ein Urteil sprechen.
20:43 Uhr.
Der Moderator stellt inzwischen die nächste Frage. Es geht um das Bürgergeld. Aber niemand hört zu. Die Talkshow läuft weiter, stumm, wie ein Spiegel. Luisa nimmt einen Schluck Wein, obwohl sie weiß, dass es sie nicht beruhigt. „Ihr hört euch gar nicht mehr zu“, sagt sie leise. „Ihr wollt euch nur noch gegenseitig besiegen.“ „Vielleicht ist das der neue Familienabend“, murmelt Smilla. „Kein Spiel. Kein Gespräch. Nur Eskalation.“
20:47 Uhr.
„Ihr redet alle von Klima, KI und Geschlechtseinträgen, aber niemand redet davon, dass dieses Land zerfällt!“, schleudert Johannes in den Raum. „Die Polizei kann in manchen Stadtteilen nicht mal mehr eingreifen! Islamisten tanzen hier auf den Gesetzen rum, und ihr denkt, ein Chatbot kann das regeln?!“ „Du hast Angst“, sagt Luisa.
„Ich hab keine Angst. Ich hab die Schnauze voll!“
Smilla steht auf. „Vielleicht solltest du wirklich mal eine andere Perspektive zulassen. Nur für drei Minuten. Wie in unserem Spiel.“ „Ich spiele nicht mit euch! Ich spiele dieses ganze Spiel nicht mehr mit! Ich bin nicht mehr euer Feindbild!“ Johannes steht auf und stellt sich vor seine Tochter. Er holt zu seinem Schlusswort aus: „Wisst ihr, manchmal sitze ich da und frag mich: Was wären wir eigentlich noch ohne die Amerikaner?“ Er schaut nicht mehr in die Augen seiner Tochter, sondern durch sie hindurch. „Ohne Google, ohne Facebook, ohne WhatsApp, Microsoft, Amazon, Netflix, Instagram, ohne ChatGPT … ohne Apple. Was wären wir da? Was hätten wir?“ Er lächelt schief, nicht freundlich. „Unsere Autoindustrie ist am Verrecken. Unsere Start-ups sind blutleer. Unser Staat braucht fünf Jahre, um einen Glasfaseranschluss zu planen – aber in der Zeit hat Kalifornien die Welt neu programmiert.“ Er sieht flehend zu seiner Frau und wieder weg. „Wir reden hier über Fortschritt und Ethik, als wären wir noch Gestalter. Aber wir sind längst zu Konsumenten geworden. Wir fressen, was andere uns vorsetzen. Wir scrollen, was andere uns erlauben. Wir glauben, was uns ein Algorithmus zuspielt.“ Er atmet schwer durch. Seine Worte sind jetzt langsamer. „Deutschland ist keine Industrienation mehr. Deutschland ist eine Digitalkolonie.“
Johannes macht eine Pause. Für ihn fühlt sich das Gesagte schwer, wahr und bitter an.
„Wir gehören niemandem mehr. Aber wir gehören auch uns nicht mehr.“ Er setzt sich wieder, kraftlos wie jemand, der nicht weiß, wohin mit sich. „Und wir wissen ja, was aus Kolonien wird, oder? Erst verliert man die Sprache. Dann die Macht. Und am Ende … die Erinnerung
daran, dass man mal frei war.
21:20 Uhr.
Der Deckenleuchte flackert kurz. Niemand reagiert.
„Ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen“, sagt Smilla. „Sie ist in Zürich. Dort sprechen alle über Präzision, Neutralität, Bildung. Und niemand schreit. Weißt du, wie sich das anfühlt?“
„Du willst auswandern?“, fragt Johannes.
„Ich will frei denken dürfen.“
„Dann geh!“, schreit er.
Stille. 21:28 Uhr.
Das Bild bleibt stehen. Im Hintergrund blinkt der Router. Alles wirkt wie eingefroren – auch die Familie. „Wir könnten in Kanada leben“, sagt Luisa nach einer langen Pause. „Ich hab dort mal studiert. Auf Vancouver Island. Dort wirkt alles weiter, ruhiger und respektvoller“ Johannes sagt nichts. „Oder Australien“, flüstert Smilla. „Dort ist KI Teil der Bildung. Nicht der Bedrohung.“
„Ich hab Angst“, sagt Johannes leise. Es ist der erste echte Satz des Abends. Kein Angriff. Kein Vorwurf. Nur Angst. „Nicht vor der KI“, sagt er. „Sondern davor, dass ihr beide in eine Welt wachst, in der ich nicht mehr vorkomme.“ Luisa atmet tief ein. „Vielleicht“, sagt sie, „geht es nicht darum, ob du vorkommst, sondern wie.“ Smilla setzt sich wieder.
22:00 Uhr.
Die Familie ist wieder still. Jeder hat ein Glas in der Hand. Der Wein schmeckt nach Asche. „Ich will nicht, dass wir wie das Land werden“, sagt Luisa. „So zerfetzt, so laut, so müde. Ich will, dass wir das aushalten.“
Smilla schaut ihre Mutter an. „Aushalten reicht nicht mehr.“
Die Tochter flüstert: „Vielleicht ist das der Fehler: Wir denken, wir müssten uns einigen. Aber vielleicht müssen wir einfach nur anfangen, einander zu übersetzen. Bevor es zu spät ist.“
Der Router blinkt immer noch wie wild – rot und gelb im Wechsel. Das Tablet ist offline, WhatsApp schweigt und der Fernseher hat immer noch ein Standbild. Auf dem Wohnzimmertisch liegt ein Wochenmagazin mit drei Headlines:
China
„Schon Grundschüler programmieren Künstliche Intelligenz“
Unterricht mit KI ab der 1. Klasse – Pilotprojekte in 1.000 Schulen gestartet
USA
„Trump fordert KI-Kindergärten für Amerika“
„Wenn China das macht, machen wir das besser“, so Trump …
Deutschland
„Sollen wir unsere Kinder vor KI schützen?“
Ethikrat warnt vor zu früher Konfrontation mit Technologie
Die SQUT-Redaktion fragt sich, wann ist es soweit, dass jede:r seinen KI-Avatar hat?
In naher Zukunft besitzt jeder Mensch einen persönlichen KI-Avatar – ein digitaler Zwilling, der rund um die Uhr ansprechbar ist, promptfähig, lernend und aktiv handelnd. Noch klingt es nach Science-Fiction, wenn dieser Avatar nicht nur die Stromabrechnung prüft, sondern bei Unstimmigkeiten selbstständig den Kundensupport kontaktiert – in einer Sprache, die andere KIs verstehen. Skeptiker warnen vor Kontrollverlust: Wer spricht da eigentlich für mich, und was, wenn mein Avatar falsche Entscheidungen trifft? Doch genau hier liegt die Zukunftsfrage: Vertrauen wir einem System, das besser verhandeln kann als wir selbst – sachlicher, schneller, fehlerfrei? Bereits jetzt kommunizieren KI-basierte Bots miteinander; der Schritt zur vollautonomen Verhandlung ist kein Sprung, sondern ein fließender Übergang. Wenn KIs beginnen, untereinander Verträge zu schließen, die rechtlich bindend sind, braucht es neue Spielregeln – für Haftung, Ethik und Transparenz. Gleichzeitig entsteht eine Revolution der Selbstbestimmung: Nie war es leichter, sich von Alltagsstress zu entlasten und dennoch vollständige Kontrolle zu behalten. Vielleicht wird die größte Herausforderung nicht technischer Natur sein, sondern emotional: Loslassen lernen. Und irgendwann wird es völlig normal sein, dass mein Avatar heute „mit dem Stromanbieter gesprochen“ hat – und wir beide zufrieden mit dem Ergebnis sind.
Und was wird dann aus den Callcentern? Und was wird aus Callcenter-Dienstleistern? Werden diese durch ihre jahrelange Erfahrung und Professionalität zu dem Backbone der Kommunikation mit Prompting-Profis statt Callcenter-Agent:innen?